Die zweite Entscheidung
Im Jahr 1969 erhielt das Bruderpaar Ingo und Udo Zimmermann, die Schöpfer der zwei Jahre zuvor uraufgeführten Oper Die weiße Rose, vom DDR-Kulturministerium den Auftrag, eine Gegenwartsoper zu schaffen.

Wie so viele andere Künstler auch, wie beispielsweise unser Rostocker Freund, der Schriftsteller Siegfried Pitschmann, dachten die Zimmermann zunächst daran, das auslösende Moment ihrer Handlung auf dem Gebiet der Kernphysik zu suchen. Aber mein Artikel im Sonntag bestärkte sie, „unsere Handlung im Bereich der biologischen Forschung ansiedeln zu sollen“.
Das schrieb mir Dr. Ingo Zimmermann am 10. August 1969 und erbat meinen Rat. In ihrem neuen Werk wollten sie beschreiben, wie einem Biowissenschaftler unserer Republik (!!!) überraschenderweise die Isolierung eines Gens gelungen sei, wie er und seine Kollegen mit dieser Entdeckung umgehen und ob „eine solche Genisolation – es bleibt wiederum ganz offen, ob sie technisch erfolgt wäre – ein wissenschaftlicher Erfolg von außergewöhnlicher Bedeutung“ sei.
Ironischerweise gelang es meinem amerikanischen Kollegen Jonathan Beckwith kurz darauf, im November 1969, tatsächlich erstmalig, ein einzelnes Gen zu isolieren. Die Brüder Zimmermann nahmen das mit großem Interesse zur Kenntnis und fühlten sich in ihrem Ansatz bestätigt.

Die Zimmermanns konnten damals noch nicht ahnen, dass sich gerade Gen-Isolierer Beckwith auch für die ethischen und sozialen Implikationen seiner Forschung interessierte und gegen deren Missbrauch engagierte. Einen entsprechenden Aufsatz von ihm habe ich ein paar Jahre später in meine OSTWALDS-KLASSIKER Sammlung zum Thema Molekulargenetik aufgenommen. Noch später bemühten sich wir uns gemeinsam bei Versuchen, den militärischen Missbrauchs der Molekularbiologie zu verhindern).

Am 12. Januar 1970 schickten sie mir das Libretto. Ich hatte einiges zu kritisieren, leider war die Oper bereits durchkomponiert und wesentlichere Textänderungen konnten nicht mehr vorgenommen werden (zumal die Landestheater Magdeburg und Dessau mit dem Termin der Uraufführung drängelten).

Ausschnitt aus dem Libretto, S, 7
Am meisten störte mich, dass die Handlung in der DDR spielen sollte. Bei uns war so etwas angesichts unseres gewaltigen Rückstandes auf dem Gebiet der Molekularbiologie völlig ausgeschlossen. Ich schrieb Ingo Zimmermann deshalb am 18. Februar 1970: „Zumindest bei Eingeweihten könnte u.U. der Eindruck entstehen: Die einen machen es tatsächlich – wir können’s nur im Theater…“
Die Uraufführung der Zweiten Entscheidung sollte dann, mit einem Tag versetzt, gleichzeitig in Magdeburg und Dessau stattfinden. Die Magdeburger wurden bei Ihrem Vorhaben sehr unterstützt durch Mitarbeiter der kurz zuvor gegründete Abteilung Humangenetik der Medizinischen Akademie. Das Landestheater Dessau dagegen sicherte sich die Unterstützung durch eine Expertengruppe des Dessauer Forschungsinstituts für Impfstoffe und durch mich. Im März 1970 nahm ich deshalb an einem Forum teil, das das Theater mit Ingo Zimmermann, den Solisten der Oper und weiteren Interessenten „zu den fachlichen und politisch moralischen Problemen, die in der Oper aufgeworfen werden“ durchführte.
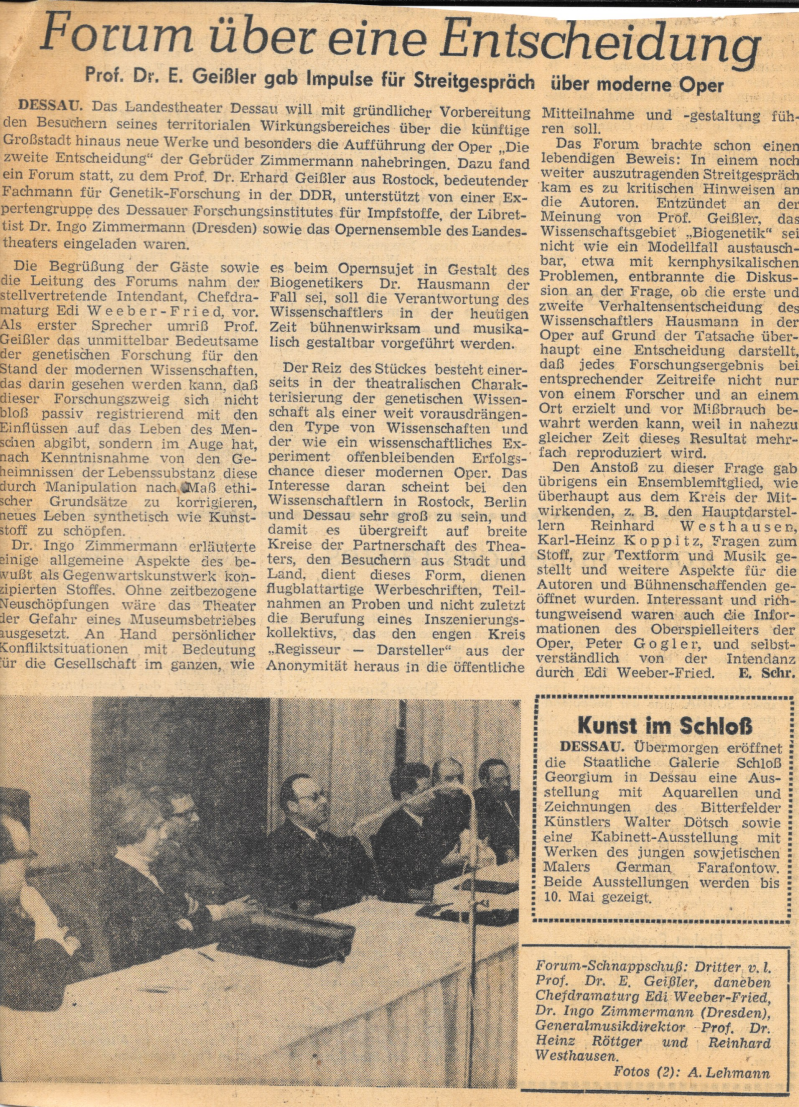
Die Veranstaltung verlief in so angeregter Atmosphäre, dass ich den Intendanten und seine Mitarbeiter spontan zur Teilnahme an dem KolloqiuKunst und Kultur in K'bornm ins Ostseebad Kühlungsborn einlud, auf dem wir im Herbst 1970 interdisziplinär über die aktuellen Ergebnisse der Molekulargenetik und deren praktischen, philosophischen und ethischen Konsequenzen diskutieren wollten. Schon wenige Tage später schrieb mir Karl Schneider, der Intendant des Dessauer Landestheaters, mein Vorschlag sei „begeistert“ aufgenommen worden. Er und der Regisseur, der Chefdramaturg und der Generalmusikdirektor würden gemeinsam mit den sechs beteiligten Solisten unserer Einladung folgen, sozusagen zum Selbstkostenpreis. Honorarforderungen entstünden keine.
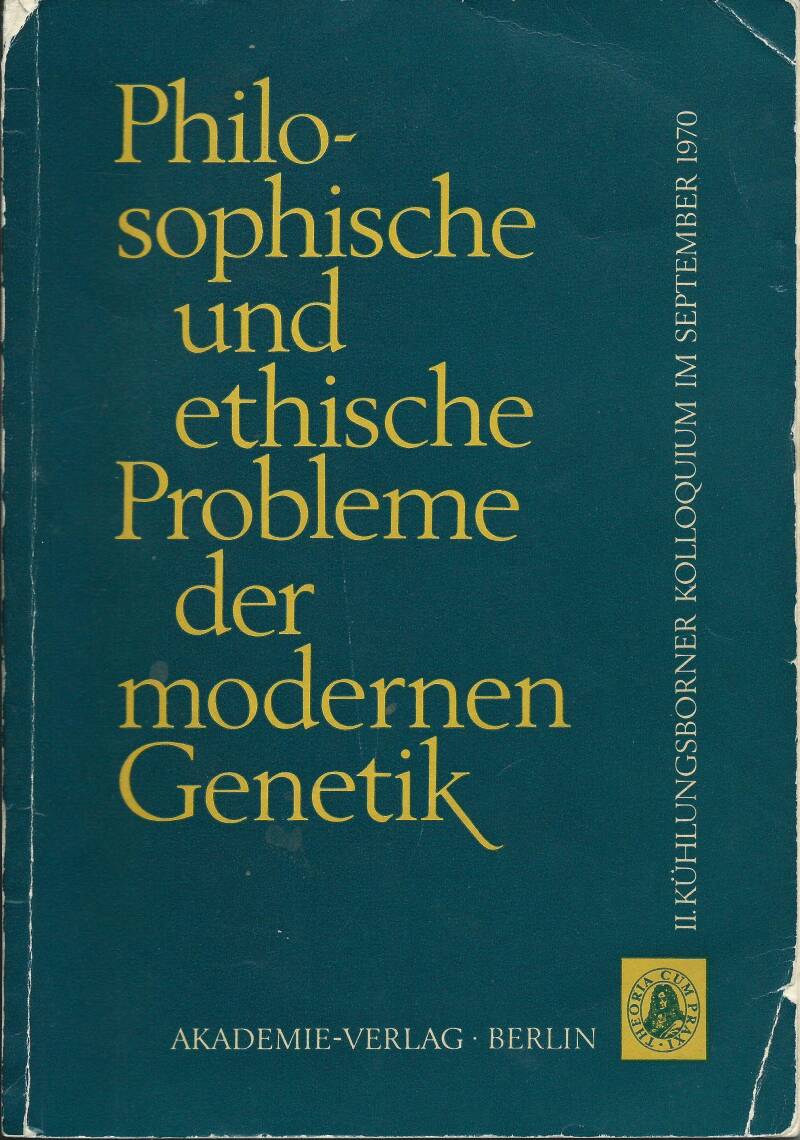
Die Theaterschaffenden hielten ihr Wort. Im Oktober 1970 führten sie ausführliche szenischen Ausschnitte aus der Oper im Kühlungsborner Kino vor. Ihre Darbietungen wurden von den Kolloquiumsteilnehmern stürmisch und begeistert gefeiert, obwohl der Generalmusikdirektor kein Orchester, sondern nur ein Klavier als Klangkörper zur Verfügung hatte. Anschließend wurde stundenlang lebhaft diskutiert, wobei die Solisten in ihre Rollen schlüpften. Der Tenor, zum Beispiel, hinterfragte kritisch seine Bühnenrolle als Direktor eines biochemischen Forschungsinstitutes. Zuvor, auf dem Forum in Dessau, war es schon dieser Sänger, der sehr engagiert auf eine kritikwürdige Schwachstelle des Sujets hingewiesen hatte: Das Einschließen des Ergebnisprotokolls in den Panzerschrank sei sinnlos. Jedes Forschungsergebnis könne bei entsprechender Zeitreife nicht nur von einem Forscher(kollektiv) und nicht nur an einem Ort erzielt werden.
Und unser Budget belastete dieser Höhepunkt des Kolloquiums nur minimal: Insgesamt kostete er uns nur 1310 Mark.
